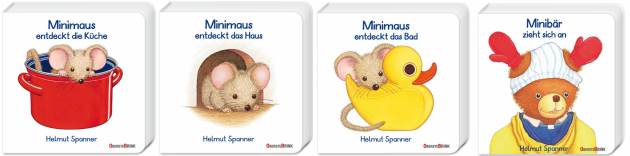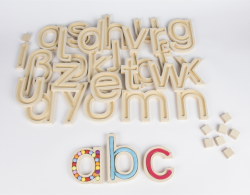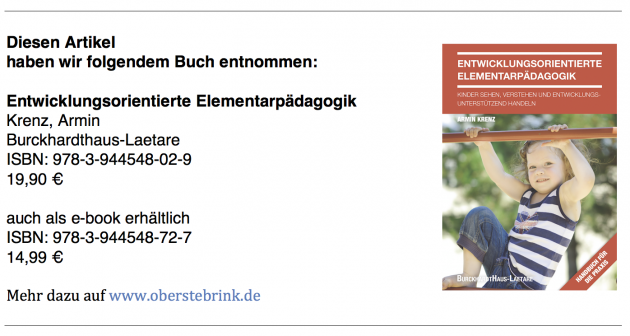2018
Qualität durch Teamarbeit
Selbstbildung als kollegiale Herausforderung

Schon seit einiger Zeit existiert für die Elementarpädagogik eine „Qualitäts- und Bildungsoffensive“, um Aufgaben, Inhalte, Vorgehensweisen, Ziele und Methoden der Arbeit zu dokumentieren. Vergessen wird dabei schnell, dass es immer schon eine Notwendigkeit war, eine deutliche Qualität im gemeinsamen Leben und Lernen mit Kindern zum Ausgangspunkt der Elementarpädagogik zu machen! Doch reichen weder hochgesetzte Ziele und schlagkräftige Schlagwörter noch markige Begriffsbezeichnungen aus, eine Qualitäts- und Bildungsoffensive voranzubringen. Vielmehr muss sich zunächst immer das Hauptaugenmerk auf die Personen und das Kollegium selbst richten, um auch tatsächlich eine hohe Qualität in der Praxis zu erreichen.
Ist ein Team tatsächlich ein Team?
Es gibt in der Elementarpädagogik – ähnlich wie in anderen Einrichtungen – kaum eine Arbeitsgruppe, die sich nicht als „Team“ bezeichnet. So wie die Begriffe „Ganzheitlichkeit der Pädagogik“ oder „Kindorientierung“ vielerorts zu inhaltsleeren Worthülsen mutiert sind, wird auch das Wort „Teamarbeit“ recht häufig vorschnell genutzt. Zunächst ist ein Team eine Leistungsgruppe, die sehr zielorientiert tätigkeitsnotwendige Aufgaben in Angriff nimmt und in effizienter Zusammenarbeit aktuelle Herausforderungen erkennt, aufgreift und konstruktiv löst. Dabei geht es primär um qualitativ hochwertige Orientierungen, zumal die Einrichtungs-, Programm- und Prozess-qualität immer von der Personal- und damit von der Teamqualität abhängig ist.
|
Merke: Eine Einrichtung ohne Teamarbeit lebt wie ein Fisch ohne Wasser bzw. eine Elementarpädagogik ohne Teamarbeit gleicht einem Auto ohne Kraftstoff – damit ist ein Vorwärtskommen ausgeschlossen. |
Vor Jahren gab es das Bild einer Aufgabenerfüllung im „Team“, bei der jeder nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten/Fertigkeiten dazu beizutragen versuchte, seinen persönlichen, individuellen Anteil einzubringen, um sich einem angestrebten Ziel zu nähern. Es ging um ein Verständnis von Teamarbeit, wo Menschen mit unterschiedlichem Know-how, unterschiedlichen Ressourcen, unterschiedlichen Werten und Normen sowie unterschiedlichen Arbeitsauffassungen durch ihre Unterschiedlichkeit die Vielfalt eines „Teams“ ausmachten. Getreu dem Motto: In der Vielfalt und Unterschiedlichkeit liegt die Stärke eines Teams. Eine solche Vorstellung führte dann aber eher nur zu Teilerfolgen, Teilentwicklungen, Teilzielerreichungen oder zu Problemverschiebungen! Trotz dieser Erkenntnisse hat sich diese Vorstellung von „Team“ in vielen Arbeitsgruppen bis heute erhalten. Die Frage nach möglichen Gründen dafür ist schnell beantwortet. Auf der einen Seite besteht gerade in der (Elementar-)Pädagogik die Annahme, dass die Individualität bzw. das individuelle Interesse des Einzelnen eine höhere Priorität besitzt als eine gemeinsame, inhaltlich notwendige Aufgabenorientierung, die es zu erledigen gibt. Auf der anderen Seite setzen Menschen persönliche Bedürfnislagen über erforderliche Arbeitsanforderungen („Mir geht es heute nicht gut“/„Das kann ich nicht, jemand anders kann es besser“/„Es gibt nicht nur den Kindergarten für mich“/„Bei besserer Bezahlung würde ich mich auch mehr einbringen“ ...). Damit machen sie sich selbst – nicht die Kinder, nicht die Profilentwicklung einer Einrichtung, nicht die Qualitätsverbesserung des Tätigkeitsfeldes – zum eigentlichen Ausgangs- und Mittelpunkt der Betrachtung. Wenn in diesem Zusammenhang die Frage aufgeworfen werden muss, warum beispielsweise die Qualität vieler elementarpädagogischer Einrichtungen nur ausreichend oder mangelhaft ist (beispielsweise in den Arbeitsschwerpunkten Öffentlichkeitsarbeit, Elternbildung und -beratung, Struktur- und Zeitmanagement, Konflikt- und Methodenkompetenz, Bildungsarbeit in Sinnzusammenhängen), dann liegt die Antwort klar auf der Hand: Persönliche Eitelkeiten und ungelöste Gruppenkonflikte blockieren qualitätsgeprägte Entwicklungen. Aufgrund dieser Erkenntnis beginnen viele Kollegien damit, zunächst eine Bestandsaufnahme ihrer „Teamarbeit” zu machen, ausgerichtet auf die Frage, ob die eigene Arbeitsgruppe tatsächlich ein Team ist.
Eine Teamcheckliste: Sind wir überhaupt ein Team?
Es ist hilfreich, wenn sich alle Mitarbeiter/-innen in einem Kollegium zunächst auf folgende Eckwertefragen konzentrieren:
- Gibt es gemeinsame handlungsleitende Werte, die auf eine persönliche und fachliche Weiterentwicklung ausgerichtet sind? Wenn ja, welche?
- Besteht tatsächlich eine positive, zielbewusste Einstellung zu selbsterfahrungs- und fachorientiertem Lernen? (Beispiele von allen Kollegen!)
- Fühlt sich tatsächlich jedes Mitglied des Kollegiums verantwortlich für das Profil der Einrichtung? Wie zeigt sich das bei wem in der Praxis?
- Schätzt jede(r) Mitarbeiter/-in ihre Fach- und Handlungskompetenzen realistisch ein und werden von jedem Schritte unternommen, das vorhandene Potenzial Schritt für Schritt auszubauen? (Beschreibung von Entwicklungen!)
- Gehören Tagesreflexionen im Hinblick auf Zielüberprüfungen zur alltäglichen Praxis und werden dabei entdeckte Defizite in konstruktive Handlungsziele umgearbeitet?
- Werden persönliche Vorlieben und Interessen mit arbeitserforderlichen Notwendigkeiten verglichen und erstere ggf. zurückgestellt? (Beispiele!)
- Bestimmt der konstruktive Dialog unter den Kollegen das tägliche Arbeitsklima oder gibt es destruktive Umgangsformen (sich aus dem Weg gehen, Oberflächlichkeit der Beziehungen)?
- Werden Erwartungen bezüglich der persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung formuliert, offen geäußert und als neue Zielsetzungen für die eigene Person angesehen?
- Werden Unstimmigkeiten im Kollegium von allen Personen thematisiert und auf sachlicher Ebene geklärt? Wer hält sich zurück bzw. zieht sich aus der Verantwortung?
- Zeigen sich alle Kollegen als faire Mit-Streiter/-innen und bringen sie fachliche Neugierde, aktive Vorschläge bei bedeutsamen Fragestellungen und sachliches Interesse bei Problemlösestrategien mit?
- Gehört ein „entdeckendes Lernen“ zum Alltag aller Mitarbeiter/-innen und unternehmen alle den Versuch, negative Merkmale der Arbeit zielorientiert zu verändern und positive Entwicklungen effektiv zu unterstützen bzw. zu toppen? (Beispiele!)
- Sind alle Kollegen in der Selbst- und Fremdbeobachtung geübt und unterstützen sie durch aktive Handlungsschritte Selbst- und Fremdentwicklungsprozesse?
- Kommen von allen Kollegen bei Dienstbesprechungen, Konferenzen und Arbeitssitzungen Impulse zur Verbesserung der Umgangskultur und des Arbeitsklimas?
Teamarbeit kennzeichnet sich also zunächst in einer zielorientierten Bestandsaufnahme des „Status quo“, weil es vor allem darum geht, den Teambegriff klar auf den Punkt zu bringen und ggf. Schwachpunkte zu verändern. So wie es einerseits kein „gutes“ oder „schlechtes“ Team gibt, gibt es andererseits doch den Begriff „Team“ selbst als ein feststehendes Qualitätsmerkmal. Andernfalls ist es eine Arbeitsgruppe, ein Kollegium oder ein Zusammenschluss von elementarpädagogischen Mitarbeiter/-innen. Wenn dem recht sorglosen und leichtfertigen Gebrauch des Begriffes „Team“ zunächst ein Riegel vorgeschoben wird, ist ein erster, aber wesentlicher Schritt im Aufbau einer Teamqualität getan.
Teamqualität und ihre Merkmale
Wenn es in der Programm- und Produktqualität einer elementarpädagogischen Einrichtung darum geht, Grundsatzfragen zu klären, konzeptionelle Eckwerte für die Pädagogik festzuschreiben und sowohl im Innen- als auch im Außenbereich transparent zu machen, den Kindern feste Bindungserfahrungen zu ermöglichen und den bedeutsamen Erziehungs-, Betreuungs- und Bildungsauftrag fachkompetent umzusetzen, bedeutsame Sachkontexte zu beachten und sinnverbundenes Verhalten zu zeigen, dann ist das Kollegium als Team der Ausgangspunkt für das Erreichen dieser Ziele.
Teamqualität zeigen heißt,
- in lebendiger Auseinandersetzung miteinander persönliche und fachliche Unterschiede zu entdecken und durch Weiterentwicklung eine gemeinsame Sicht- und Verhaltensbasis aufzubauen;
- Beziehungen miteinander zu thematisieren und dort, wo es nötig ist, Klärungsprozesse einzuleiten, um Widerstände, Vorurteile, Misstrauen und zurückliegende Verletzungen abzubauen;
- Selbstverantwortung zu übernehmen und an den Stellen zu zeigen, an denen eine fachliche Profilierung angezeigt ist;
- persönliche Ressourcen und eigene Potenziale immer wieder aufs Neue zu entdecken, aufzunehmen und auszubauen;
- sich mit der Arbeit, den Zielen und fachlichen Aufgaben der eigenen Einrichtung zu identifizieren, um dem Haus ein unverwechselbares Profil geben zu können;
- zurückliegende Erfahrungen auf ihren heutigen Bedeutungswert zu überprüfen und neue Visionen zuzulassen, damit aktuelle und künftige Anforderungen schon in der Gegenwart strukturiert vorbereitet werden können;
- regelmäßige Dienstbesprechungen mit allen Beteiligten für fachliche Gespräche und Arbeitsplanungen zu nutzen;
- bei Arbeitsvorhaben entsprechend einer Prioritätenliste Schwerpunkte zu setzen, bei denen jedes Mitglied des Kollegiums eine entsprechend anspruchsvolle Aufgabe übernimmt;
- bei schwierigen Problemen oder größeren Konflikten hilfreiche Einigungsprozesse einzuleiten, um Beziehungsschwierigkeiten zu minimalisieren und Sachklärungen in den Vordergrund zu stellen;
- motiviert, neugierig, engagiert und innovativ an einer Teamkultur mitzuarbeiten, sodass trotz aller neu auftauchenden Probleme und Fragestellungen ein gutes Klima für sachorientierte Pädagogik hergestellt ist;
- Konflikte als eine Herausforderung zu begreifen, in der es nicht um Sieger und Verlierer, sondern um Chancen der individuellen und institutionellen Entwicklung geht.
Ohne Frage ist ein Team damit die Quelle für Produktivität, Fantasie, Kreativität und gleichzeitig Realitätsbewusstsein. Damit ist ein Team auch ein Medium für lebendige Kommunikation und ein Ort für Sozialkompetenz und Fachorientierung. Das Team wird dann als Motor dafür wirken, nötige Arbeitsreformen zuzulassen und Systemveränderungen zu ermöglichen. Ein Team zeichnet sich als ein Ort der Leistungsmotivation aus und dient ganz nebenbei als Korrektiv für destruktiv eingeschlagene Arbeitswege.
Stolperfallen für die Teamentwicklung
Die Entwicklung von der Gruppe, dem Kollegium zum Team ist ein arbeitsintensiver Prozess, bei dem jeder dazu beitragen muss, dass diese Entwicklung in Gang gesetzt wird. Häufig gibt es Verhaltensweisen, die es einer Gruppe erschweren, sich zu einem Team zu entwickeln. Vor allem sind es immer wieder dieselben Vorstellungen, die – offen oder verdeckt – dafür sorgen, dass Prozesse nicht vorankommen. So unterbricht ein „Harmonieverständnis“ die Dynamik, Dinge auf den Tisch zu bringen, um beispielsweise „alte Geschichten“, die sogenannten „Leichen im Keller“ zu thematisieren. Gleichzeitig werden oftmals „Problemmantelpunkte“ diskutiert, nicht selten in epischer Länge, durch die die eigentlichen Problemkerne verdeckt und ausgeklammert werden. „Fehlende Selbstkritik“ oder „Selbstdarstellungsversuche“ lenken von thematischen Schwerpunkten ebenso ab wie Rivalitäts- oder Machtkämpfe, die einzig und allein dem Ziel dienen, individuelle Beziehungsgefechte zu gewinnen.
Das Team als Klassifikation für Qualität und Güte
Das Team als Klassifikation für Qualität und Güte orientiert sich an professionellen Maßstäben, um mit Fach-, Sach- und Methodenkompetenz ein inhaltlich gesetztes Ziel zu erreichen. Das „offene Feedback“ als Einführung in einer Dienstbesprechung ist dabei ein ebenso großer Zeitkiller wie das Bestehen auf Begriffe wie z. B. „Offenheit“ oder „Toleranz“. Solche Schlagwörter sind in einer professionellen Pädagogik nicht mehr zu finden, ebenso wie zeitraubende Einstiegsrunden. Qualitätskriterien geben spezifische Anforderungen an Verhaltensmerkmale vor: Insofern ist Intoleranz gegenüber denjenigen Verhaltensweisen erforderlich, die eine Qualitätsentwicklung verhindern. Und wer unter Offenheit die Anforderung versteht, jede neue bildungspolitische Strömung zu verfolgen, vergibt die Chance einer sorgfältigen Prüfung, ob der neue Impuls tatsächlich nutzbar oder nutzlos, vielleicht sogar kontraproduktiv ist. Die Arbeit im Team hat sich den inhaltlichen Aufgaben einer Einrichtung zu stellen, in der Kinder entwicklungsförderliche oder -hemmende Einflüsse erfahren. Persönliche Befindlichkeiten sollten dabei stets im privaten Bereich geklärt werden (was nicht heißt, eine Beziehungskultur durch wertorientiertes Verhalten zu pflegen!).
Statt des „Spiegelns von Empfindungen als Form der Rückmeldung“ geht es um direkte, deutliche Auseinandersetzungen, die durch Klarheit und ein Interesse an allen Personen charakterisiert sind. Statt um „Rücksichtnahme auf Befindlichkeiten“ geht es um problemverändernde Verhaltensanforderungen an sich selbst und andere, darum Unstimmigkeiten und Problemstellungen strukturiert auf den Tisch zu legen. Und wenn es in der Entwicklung von Teamarbeit immer wieder an nicht ausreichender Motivation zur Weiterentwicklung, an fehlendem Engagement, an unzureichenden Qualifikationsmerkmalen und an zu niedrigen Leistungsstandards liegt, dass Qualität in Kinderschuhen stecken bleibt, dann muss es dem Kollegium gelingen, Grundsätzlichkeiten zu klären! Und darin liegt stets der Kern von Teamentwicklungsprozessen. Erst wenn sogenannte Problemmantelpunkte (also Nebensächlichkeiten) beiseitegelegt und „Problemkerne“ (Aufgaben mit erster Priorität) inhaltlich gelöst werden, erst dann kann das Augenmerk auf eine von Qualität geprägte Elementarpädagogik gelenkt werden.
Foto: drubig-photo www.fotolia.de

Diesen Artikel haben wir aus dem Buch von Armin Krenz mit dem Titel „Grundlagen der Elementarpädagogik“ entnommen. Das Buch ist bei Burckhardthaus-Laetare erschienen.
Grundlagen der Elementarpädagogik
Unverzichtbare Eckwerte für eine professionelle Frühpädagogik
Krenz, Armin
Burckhardthaus-Laetare
ISBN/EAN: 9783944548036
22,00 €
Hartz-IV-Regelsatz für Kinder um 5 bis 6 Euro erhöht

Das Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW) fordert die Bundesregierung auf, für die Bekämpfung der Kinderarmut in Deutschland endlich grundlegende Reformschritte in die Wege zu leiten und ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Dazu braucht es aus Sicht der Kinderrechtsorganisation im Rahmen einer Gesamtstrategie ein Bundeskinderteilhabegesetz, das Kinder und Jugendliche einerseits materiell absichert und zugleich eine nachhaltige soziale Infrastruktur gewährleistet. Die zum 1. Januar 2019 vorgesehene Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes für Kinder und Jugendliche um fünf bzw. sechs Euro ist nach Ansicht des Verbandes angesichts des nachhaltigen Problems der Kinderarmut in Deutschland nicht mal mehr ein Tropfen auf den heißen Stein.
„Durch ein Bundeskinderteilhabegesetz könnten arme Kinder und Jugendliche in Deutschland besser erreicht werden und die ihnen zustehenden Sozialleistungen auch tatsächlich in Anspruch nehmen. Ein Gesetz, das auf der einen Seite transparent Rechtsansprüche auf Förderung und Teilhabe sicherstellt und auf der anderen Seite regelt, wie die Kommunen vom Bund finanzierte infrastrukturelle Bildungs- und Teilhabeleistungen vor Ort umsetzen, könnte armutsbetroffene Kinder und Jugendliche nachhaltig aus der Armutsfalle herausführen. Es darf nicht vom Wohnort abhängen, ob arme Kinder und Jugendliche gut versorgt und gefördert werden. Der föderale Flickenteppich der regionalen Armutsbekämpfung muss mit einer bundesweiten Gesamtstrategie beendet werden. Sofern eine Änderung des Grundgesetzes zur wirkungsvollen Umsetzung eines solchen Vorhabens notwendig ist, sollte diese zügig in Angriff genommen werden“, betont Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes.
Das Deutsche Kinderhilfswerk begrüßt es sehr, dass die Bundesregierung mit dem Referentenentwurf für ein „Starke-Familien-Gesetz“ armutsbetroffene Kinder und Jugendliche stärker in den Blick nehmen will. „Aber leider bleiben die vorgesehene Reform des Kinderzuschlags und die beabsichtigen Änderungen des Bildungs- und Teilhabegesetzes auf nicht einmal halber Strecke stehen. Ein generelles Manko bleibt beispielsweise, dass der Kinderzuschlag weiter zu kompliziert bleibt, und eine automatische Auszahlung nicht in Angriff genommen wird. Beim Bildungs- und Teilhabegesetz beschränken sich die Reformen nur auf den schulischen Bereich, der Freizeitbereich und andere Förderungs- und Teilhabemöglichkeiten wie Sportvereine oder Musikschulen bleiben außen vor. Hier wünschen wir uns mehr Mut von der Bundesregierung für einen großen Wurf bei der Armutsbekämpfung von Kindern und Jugendlichen. Dazu gehören auch eine entsprechende Priorisierung der finanziellen Mittel in der Familienförderung insbesondere armer Familien und ein Ende der bisherigen komplizierten Beantragungsprozeduren und komplexen Anrechnungsregelungen für Leistungen, auf die Kinder und Jugendliche ein Anrecht haben“, so Krüger weiter.
Langfristig tritt das Deutsche Kinderhilfswerk für die Einführung einer bedarfsgerechten Kindergrundsicherung nach dem Modell des Bündnisses KINDERGRUNDSICHERUNG ein, die den bestehenden Familienlastenausgleich ablöst, bestehende kindbezogene Leistungen bündelt und das soziokulturelle Existenzminimum von Kindern unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Familie, der Familienform und dem bisherigen Unterstützungssystem bedarfsgerecht gewährleistet.
Mit Schwung und Dreh auf's Kita-Parkett
Tanzspiele und Bewegungslieder

Kinder lieben es zu tanzen – da kommt dieses Seminar mit kurzen, einfachen Choreografien genau richtig! Mit ruhigen, lustigen oder modernen Tanzstücken und übersichtlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen will Sabrina Adomeit auch „Nicht-TänzerInnen“ schnell zu gelungenen Tanz- und Bewegungseinlagen auffordern. Das Angebot eignet sich für altersgemischte Gruppen mit Kindern im Alter von drei bis sieben Jahren. Zu den Schwerpunkten des Seminars gehören:
- Materialerfahrung mit Seilen, Tüchern, Reifen u. a.
- Kennenlernen von Tanzspielen und Bewegungsliedern
- Praktische Umsetzung in der Gruppe
Das Seminar findet am 12. März in der Zeit von 9 bis 17 Uhr in Pforzheim-Hohenwart statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 118 Euro.
Das Prinzip der Achtsamkeit
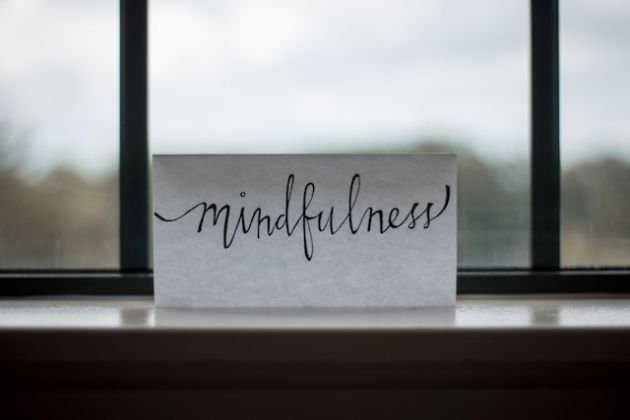
Motivation und Erfolg
Der Schlüssel für die Bewältigung vieler Probleme ist die praxisbezogene und kontinuierliche Entwicklung einer selbstbewussten und souveränen Persönlichkeit. Nur so lässt sich auf die gewachsenen gesellschaftlichen Anforderungen angemessen reagieren.
Im hektischen Kindergartenalltag brauchen ErzieherInnen Ruhe und Gelassenheit, um die zahlreichen Anforderungen zu bewältigen. Die Motivation, achtsam und aufmerksam zu leben, und die Motivation, klar und zielbewusst zu handeln, reduzieren die Gefahr, immer wieder von Neuem in die „Stressfalle“ zu tappen.
Gruß an die Morgendämmerung
Sieh diesen Tag!
Denn er ist Leben, ja das Leben selbst. In seinem kurzen Lauf
liegt alle Wahrheit. Alles Wesen deines Seins:
Die Seligkeit zu wachsen,
die Freude zu handeln, die Pracht der Schönheit;
denn Gestern ist nur noch ein Traum,
und Morgen ist nur ein Bild der Fantasie,
doch Heute, richtig gelebt, verwandelt jedes Gestern
in einen glückseligen Traum
und jedes Morgen in ein Bild der Hoffnung.
So sieh diesen Tag genau!
Das ist der Gruß der Morgendämmerung.
Kalidasa (indischer Dramatiker)
Das Leben, erkennen wir zu spät, muss gelebt werden, in jedem Augenblick des Tages und der Stunde.
Stephen Leacock
Achte auf deine Gedanken – sie werden Worte.
Achte auf deine Worte … sie werden Handlungen.
Achte auf deine Handlungen – sie werden zu Gewohnheiten.
Achte auf deine Gewohnheiten – sie werden dein Charakter.
Achte auf deinen Charakter – er wird dein Schicksal.
Konfuzius
Achtsamkeit ist Wertschätzung des Augenblicks. Achtsamkeit führt hin zur Entdeckung des Wesentlichen. Achtsamkeit sensibilisiert unsere Wahrnehmung nach innen wie nach außen. Achtsamkeit schult unsere Sinne und lehrt Konzentration. Achtsamkeit ermöglicht Präsenz, nämlich im Moment da zu sein. Achtsamkeit ist Wachsein, das unser Bewusstsein für das Tun und für das Aufnehmen von Geschehnissen schärft. Der Dalai Lama fasst die Bedeutung von Achtsamkeit so zusammen: „Achtsamkeit kommt aus einem stark entwickelten Bewusstsein für die eigenen körperlichen und verbalen Handlungen, was sich auch auf die Traumwelt überträgt. Wenn man dem eigenen Verhalten beim Essen, Kommen und Gehen, Stehen und Sitzen und so weiter sehr genau Beachtung schenkt, dann schlagen die Bedingungen für Achtsamkeit kräftige Wurzeln.“
Das Handeln (Tun) und die Achtsamkeit (Präsenz) sind ein „unschlagbares Team“ für ein gelungenes, erfülltes und glückliches Leben – ein „Traumpaar der Motivation“. Unser Grundverständnis für das Handeln und die Achtsamkeit ist der Türöffner für ein bewussteres Leben, für mehr Lebensqualität und für Lernfähigkeit (Veränderungsfähigkeit). Passt dieses Verständnis von Achtsamkeit überhaupt in unsere Kultur- und Lebenswelt, mögen Sie, liebe/r LeserIn, sich (selbst-)kritisch fragen. Sie stellen sofort einen Bezug her zu Ihrer unmittelbaren Lebensumwelt in der Privatsphäre und im Beruf und betrachten dabei die Geschäftigkeit des Alltags, Ihres Alltags: die Hektik, die Beschleunigung, das unerhörte Tempo des Informationszeitalters, die rasante Vermehrung des Wissens, die wachsenden beruflichen Anforderungen und der kaum noch zu ertragende Zeitdruck. Sie sehen sich in einer schnelllebigen Zeit, in der die Menschen zunehmend die Orientierung und den Sinn für ihr Tun zu verlieren scheinen und in der dies unmittelbar an den Kindern im Kindergarten abzulesen ist, die mit steigender Tendenz Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Doch genau mit dieser Wahrnehmung der (Um-)Welt spüren Sie allmählich, dass Sie sich mittendrin befinden in der Anpassungs- und Beschleunigungsfalle.
Wir leben in einer Weit des Multitasking, was übersetzt in etwa heißt, dass wir mehrere Aufgaben zur gleichen Zeit erledigen (müssen). Das konkrete Bild ist Ihnen vertraut, wenn Sie über einen Zeitraum von vielleicht mehreren Tagen Ihre Kindergartengruppe allein zu betreuen haben, weil Ihr/e KollegIn erkrankt und keine Vertretungsregelung möglich ist. Gezielte elementarpädagogische (Projekt-)Arbeit ist dann kaum möglich, weil die Einflüsse der Kinder und die organisatorischen Aufgaben, abgesehen von Ihren persönlichen Bedürfnissen und Vorhaben, kumulieren. Sie haben das Gefühl, nur noch zu reagieren, und sind mit der Lösung Ihrer Aufgaben mehr als unzufrieden. Diese Situation kostet Ihre Kraft und Energie, und nachmittags bzw. abends fahren Sie erschöpft nach Hause – ach ja, da ist ja noch Ihre Familie und/oder der Haushalt. Ist es nicht so? Sie nehmen Ihre beruflichen Sorgen mit nach Hause und „sorgen“ oder gar „ängstigen“ sich vor dem Morgen. Schließlich spürt Ihr privates Umfeld Ihre Unruhe und bekommt überdies Ihre Nervosität zu spüren – das harmonische, ausgleichende und aufbauende Miteinander leidet. Und morgens, wenn Sie aufwachen, möglicherweise nach einer unruhigen Nacht. haben Sie das Gefühl, Hunderte von Dingen an diesem Tag erledigen zu müssen. Ihre Gedanken fahren Achterbahn. Nichts geschieht in voller Achtsamkeit und Konzentration. William Osler sagt hierzu: „Wenn die Bürde von morgen mit der von gestern getragen werden muss, wankt auch der Stärkste“, fügt hinzu: „Der Rettungsanker ist das Heute!“, und meint die Bewältigung der Aufgaben, und zwar Schritt für Schritt.
Wenn wir also nicht eins nach dem anderen tun, langsam und gleichmäßig, so wie die Körner durch die Sanduhr rinnen; wenn wir nicht konzentriert und bewusst die auf uns einfließenden Aufgaben angehen, dann werden wir irgendwann körperlich und geistig zusammenbrechen. Die Motivation, achtsam und aufmerksam zu leben, und die Motivation, klar und zielbewusst zu handeln (zu verändern), verhindert oder reduziert zumindest die Gefahr, immer wieder von Neuem in die „Stressfalle“ zu tappen. Prof. Dr. Dr. Spitzer beschreibt die Stresssituation so:
„Wer etwas tun kann (in einer Situation), der hat keinen Stress; wer hingegen nicht weiß, was auf ihn zukommt und die Situation nicht beeinflussen kann, der hat Stress.“
Kommen wir noch einmal zurück auf den Eingangssatz: „Achtsamkeit ist Wertschätzung des Augenblicks.“ Diese Erkenntnis beginnt immer bei der Person selbst und meint die Wertschätzung sich selbst gegenüber; sie meint die Selbstachtung, das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein. Allein aus dieser Erkenntnis heraus können Sie Ihre persönliche Lebensstrategie entwickeln und alles dafür tun, bewusster und würdevoller mit sich selbst umzugehen. Sie haben immer die Chance, „Ihren eigenen Garten nach Ihren Vorstellungen zu pflegen“ und die Samen einzupflanzen, die Wachstum und Reife ermöglichen (vgl. hierzu den Abschnitt „Self-Coaching“).
Ohne die eigene, persönliche Wertschätzung ist die Wertschätzung des anderen oder des menschlichen Umfeldes kaum vorstellbar, erfahrbar und lebbar. Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar oder – bitte verzeihen Sie mir diese Provokation – wer mit seinem Leben nicht fertig wird, hat die Tendenz, andere fertig zu machen! In diesem Zusammenhang wird das 3. Prinzip der Lebenswerte bedeutsam, nämlich sich ein klares Wertebild darüber zu machen, was richtig oder falsch, gut oder schlecht usw. ist. Und schließlich meine ich die Achtsamkeit gegenüber Objekten und Sachverhalten, die Voraussetzung dafür ist, sich und das Leben zu erschließen, Ereignisse und Handlungen zu verstehen.
Entwickeln Sie eine „Objektsprache “, die Sie für das Detail sensibilisiert, sei es am Beispiel „Faszination Natur (,Der Blütenzauber!‘), Farbe oder (menschlicher) Körper“, also alles, was Form und Inhalt hat. Entwickeln Sie eine Körpersprache, die achtsam und aufmerksam im Einklang steht mit Ihrem Denken und Ihrem Gefühl; stellen Sie eine Kongruenz her zwischen Wollen und Machen. Entwickeln Sie Ihre Sprache, Ihren verbalen Ausdruck, und finden Sie das Maß und die Wirkung; denn wir wissen alle, ein Wort zu viel oder zu wenig kann unzählige Steine ins Rollen bringen und schlimmstenfalls hinterlassen sie einen Geröllhaufen. Seien Sie also ein Meister der bewussten Wahrnehmung; Sie erreichen die „Meisterschaft“ nur durch Handeln und Achtsamkeit. Theodor Fontane hilft in diesem Prozess ungemein, wenn er erkennt: „In der Ruhe liegt die Kraft.“
Wir wissen, dass unser Gehirn nur einen Gedanken zurzeit denken kann, nicht mehrere Gedanken auf einmal. Wir denken analog. Und weil das so ist, können wir eine Aufgabe nur Schritt für Schritt lösen und nicht mehrere Dinge gleichzeitig. Es ist ein Irrglaube (häufig von Frauen angeführt!), dass Frauen mehrere Dinge zur selben Zeit „besser“ als ihr geschlechtliches Pendant ausführen können. Dies und wie so vieles andere ist keine Geschlechterfrage. Gehen Sie Ihren Aufgaben konzentriert und Schritt für Schritt nach, und entwickeln Sie dabei eine innere oder gar „gespannte“ Ruhe, dann spüren Sie die Kraft, die Fontane meint. Franz Werfel fasst das eben Gemeinte treffend zusammen: „Zwischen zu früh und spät liegt immer nur ein Augenblick.“
10 Übungen zur Entwicklung der persönlichen Strategie: Bewusst machen – Standort bestimmen – verändern
- Betrachten Sie Ihren Tagesablauf, und stellen Sie die Phasen dar,
a) in denen Sie konzentriert und aufmerksam Ihren Aufgaben nachgehen (können).
beruflich:
privat:
b) in denen Sie mehrere Aufgaben zur gleichen Zeit erledigen (müssen).
beruflich:
privat: - Woran liegt es, dass Sie sich
a) Ihren Aufgaben voll widmen können bzw.
b) der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nicht konzentriert und in Ruhe Schritt für Schritt nachgehen können? - Machen Sie sich klar, welche Aufgaben/Tätigkeiten Sie
a) gern ausführen:
b) ungern ausführen: - Welche Motivation steht bzw. welche Beweggründe stehen
a) hinter den Aufgaben, die Sie gern ausführen:
b) hinter den Aufgaben, die Sie ungern ausführen: - Schauen Sie sich Ihren Tagesablauf einmal genauer an, und machen Sie sich klar, welche Tätigkeiten Sie routiniert ausführen und welchen Grad der Beachtung Sie diesen Routinetätigkeiten schenken!
- Was hindert Sie daran, Ihren Aufgaben konzentriert nachgehen zu können?
a) Äußere Einflüsse:
b) Wechselnde Gedanken (berufliche/private Probleme):
c) Andere Einflüsse: - Beobachten Sie sich: Welche Gedanken haben Sie, wenn Sie morgens aufwachen? Schreiben Sie an einem Morgen auf, welche Gedanken Sie beschäftigen!
- Trainieren Sie Ihre Achtsamkeit. Machen Sie sich immer wieder von Neuem Ihre Tätigkeiten bewusst! Achten Sie darauf, ob Sie das Essen genießen, ob Sie morgens mit Freude und nicht allein der Hygiene wegen duschen, ob Sie bewusst gehen und nicht nur durch die Gegend hetzen …
- Trainieren Sie Ihre Wahrnehmungsfähigkeit. Schildern Sie den Weg zu Ihrer Arbeitsstätte, protokollieren Sie eine Nachrichtensendung oder ein wichtiges Gespräch, beschreiben Sie Gegenstände, Klänge, Düfte …
- Trainieren Sie Ihr Namensgedächtnis. Konzentrieren Sie sich auf Namen, und bringen Sie diese mit Bildern, Eigenschaften und besonderen Details in Verbindung! Probieren Sie diese Übung in Ihrer beruflichen und privaten Praxis aus.
Das hilft Ihnen: 10 Empfehlungen für das Prinzip der Achtsamkeit
- Seien Sie bei allem, was Sie tun, aufmerksam, und finden Sie sich hinein ins „Hier und Jetzt“.
- Worte haben Zauberkraft: Schreiben Sie nur fünf Buchstaben auf den wertvollsten Untergrund, den Sie kennen und den Sie unmittelbar sehen, z. B. wenn Sie am Morgen Ihre Augen öffnen: „HEUTE“ . So machen Sie sich immer wieder von Neuem bewusst, worauf es ankommt, nämlich voll und ganz bei sich und im Augenblick zu sein.
- Beginnen Sie den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück! Beziehen Sie Ihr Umfeld ein, entdecken Sie (wieder) den Genuss, und lassen Sie Ihre/n PartnerIn, Ihre Kinder daran teilhaben. Das ist „Ihr Gruß an die Morgendämmerung“ und ein gelungener Tagesbeginn.
- Nehmen Sie sich am Abend 15 Minuten Zeit und schreiben Sie in Stichpunkten die Dinge auf, die Ihnen gelungen sind oder über die Sie sich gefreut haben. Sie werden mindestens drei positive Beispiele finden. Das sind in der Woche 21, im Monat 90 und im Jahr 1.080 wirklich stattgefundene positive Erlebnisse! Schon nach kurzer Zeit wird Ihnen bewusst, dass Ihnen viel mehr gelingt, als Sie annehmen bzw. zuvor angenommen haben. Und Ihr Selbstwertgefühl und Ihre Selbstsicherheit werden wachsen.
- Schreiben Sie auch die Dinge auf, die Ihnen am Tag nicht gelungen sind oder die Sie als negativ empfunden haben. Mit dieser Strategie vermeiden Sie z. B. die Häufigkeit von Fehlern und sind bestens darauf eingestellt, künftig angemessener und souveräner zu reagieren.
- Schauen Sie zu Hause oder am Arbeitsplatz gedanklich in einen Spiegel, auf dem zu lesen steht: „So sieht mich meine Familie, mein/e PartnerIn bzw. so sehen mich die Kinder, Eltern und KollegInnen heute!“ Auf diese Weise entwickeln Sie Humor; Ihnen wird zunehmend bewusst, welche Bedeutung Ihre Ausstrahlung hat und vor allem, dass ein Lächeln – so schwierig die persönliche Situation im Moment auch sein mag – eine positive Wirkung sowohl nach innen als auch nach außen hat. „Wer den Tag mit einem Lächeln beginnt, hat ihn bereits gewonnen!“ (Tschechischer Sinnspruch)
- Fangen Sie noch heute damit an, sich nach innen und außen Grenzen zu setzen. Sagen Sie nicht „Ja“, wenn Sie „Nein“ meinen. Und zeigen Sie nach außen, dass das, was Sie in Ihren Verhaltensweisen verändert haben, Ihnen guttut und schließlich auch Ihrem Umfeld zugutekommt. So werden Sie sich immer mehr zutrauen und mehr leisten.
- Organisieren Sie jeden Tag so gut wie möglich, und schreiben Sie die wichtigsten Schritte auf. Diese Technik schult Ihre Selbstdisziplin und Konzentration. Sie werden sukzessive feststellen, dass Ihnen immer mehr gelingt.
- Machen Sie sich bewusst: „Weniger ist mehr!“ Setzen Sie diesen Grundsatz in Ihrer Sprache, Ihren Ansprüchen und Ihrem Verhalten um. Allmählich schält sich das Wesentliche, das, worauf es ankommt, heraus. Dabei lernen Sie vor allem, dass Sie nicht immer alles begründen oder legitimieren müssen.
- Belohnen Sie sich in Phasen, in denen Sie sich negativ gestresst fühlen. Dies kann eine kleine Auszeit sein, die Sie auch an hektischen Arbeitstagen nehmen können. Ein kurzer Spaziergang zum Durchatmen und Abstand gewinnen, ein Cappuccino im nahe gelegenen Café oder gar im Kindergarten, ein „Rückzugsgespräch“ mit einer Ihnen vertrauten Person oder KollegIn: Dies sind kostengünstige Möglichkeiten und ersetzen mitunter den teuren Psychologen.
Zusammenfassung
- Das Prinzip der Achtsamkeit ist die bewusste Wahrnehmung des Augenblicks.
- Achtsamkeit ist Wertschätzung sich selbst gegenüber, sie stärkt die „Selbstachtung“ und fördert das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein.
- Achtsamkeit unterstützt die „bewusste Annahme des unmittelbaren menschlichen und sächlichen Umfeldes“ und entwickelt die Wertschätzung des „Außen“.
- Die volle „Aufmerksamkeit des Augenblicks“ fördert Konzentration und Selbstdisziplin.
- Achtsamkeit verhilft zu einem bewussteren Leben und erschließt das Wesentliche in den kleinen und großen Dingen. Dies führt zu der grundsätzlichen (Lebens-)Erkenntnis, dass „weniger mehr ist“ und zum richtigen Maß des (verbalen, nonverbalen oder schriftlichen) Ausdrucks, von der die Wirkung beeinflusst wird.
- Achtsamkeit sensibilisiert Ihre Wahrnehmung.
- Der achtsame Umgang mit sich selbst, der Körpersprache und dem Ausdruck, mit anderen Menschen, der Natur, Objekten und Sachverhalten verbessert die Kommunikation, soziale Kompetenz und persönliche Ausstrahlung.
- Fehler entstehen zumeist aus Unachtsamkeit oder einem Mangel an Aufmerksamkeit, weniger aus Unkenntnis oder Unwissenheit. Deshalb sollte man sich bei jedem Fehler zunächst offen und ehrlich die selbstkritische Frage stellen, ob man bei der Aufgabe zu 100 Prozent bei der Sache war.
- Achtsames Handeln ist „Da-Sein“, also die volle Präsenz schlechthin; es führt zu einer Verbesserung der Lebensqualität, zu einem erfüllteren und glücklicheren Leben.
- Jede Aufgabe lässt sich nur Schritt für Schritt erfolgreich ausführen, wir können nur einen „Gedanken zurzeit“ denken und lernen daraus, dass der Glaube, mehrere Aufgaben seien gleichzeitig zu lösen, letztlich ein Irrglaube ist. Bismarck sagte dazu: „Jage niemals zwei Hasen auf einmal!“
- „Carpe diem“ heißt „Nutze den Tag“ und meint die volle Aufmerksamkeit für das „Hier und Jetzt“. Es bedeutet auch „Genieße den Tag!“, damit man nicht für sich selbst und andere „ungenießbar“ wird!
Meine Diamanten
Ich halte folgende drei Punkte fest, die mir zum Prinzip der Achtsamkeit besonders wichtig sind:
1._______________________________________
2._______________________________________
3._______________________________________
Foto: Martina Taylor/pixelio.de
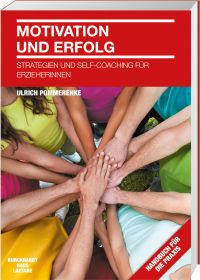
Diesen Artikel haben wir aus Ulrich Pommerenkes Buch mit dem Titel „Motivation und Erfolg“ entnommen. Das Buch ist bei Burckhardthaus erschienen.
Ulrich Pommerenke
Motivation und Erfolg
Strategien und Self-Coaching für Erzieherinnen
Broschur, 212 Seiten
ISBN 978-3-934548-05-0
Luises Weihnachtsgeschichte
Zum Vorlesen und als Gesprächsanlass

Da vorne stand Marcus in seinem schwarzen Kurrendemantel mit dem weißen Kragen. Seine Haare hatte er ausnahmsweise mal gekämmt. Luise musste leise kichern, als sie ihren Bruder dort vorn singen sah. Sonst trug er nur Jeans und Sweatshirt (Hemden mochte er nicht, weil ihm das Knöpfen zu viel Arbeit machte).
Allerdings – ein bisschen neidisch war sie auch auf ihn. Luise war noch ein Jahr zu jung für die Kurrende. Nächstes Weihnachten würde sie auch mit da vorne stehen und singen. Aber in diesem Jahr saß sie noch am Heiligabend mit Mama und Papa zwischen den vielen anderen Leuten in der Kirche. Richtig feierlich war es: Die Kerzen tauchten mit ihrem Flackern die Kirche in ein ganz besonderes Licht – viel schöner, als Lampen das konnten. Neben dem Altar stand ein riesiger Christbaum, der mit Strohsternen und Pfefferkuchen geschmückt war. Weit oben baumelte der gelb-leuchtende Adventsstern und hinter ihr...
Das Krippenspiel begann. Maria und Josef kamen herein.
Natürlich kannte Luise die Weihnachtsgeschichte schon – und sie kannte auch Ina, die die Maria spielte und sie wusste, dass der Josef eigentlich Alexander heißt. Maria würde bald ein Kind bekommen und eigentlich müsste sich Josef sehr um sie kümmern – aber der passte bloß auf, dass die Kerze in seiner Laterne nicht verlosch. ,Also so was‘, dachte Luise, ,wenn ich die Maria wäre, dann würde ich dem Josef was erzählen!!‘
Naja, wenigstens ein Zimmer suchen ging er. Er klopfte an die Tür eines Wirtshauses. Die Wirtin Peggy öffnete, aber sie wollte Maria und Josef nicht hereinlassen, weil alle Zimmer bereits vermietet waren. „Mama?“, flüsterte Luise, „warum bringt die Wirtin die beiden nicht in den Stall?“ Kaum hatte Luise das gefragt, kam die Wirtin selber auf die Idee. Sie nahm Maria und Josef mit zum Stall – und schon durfte Marcus mit der Kurrende wieder ran.
Nun kam die Geschichte mit den Hirten: Das waren Jens, Frank und Roland. Die mussten irgendwelche Schafe bewachen, die Luise noch nie gesehen hatte. Alle drei Hirten waren furchtbar müde, obwohl es erst nachmittags um vier war. Einer musste wachbleiben und auf die Schafe aufpassen. In diesem Jahr traf es Roland. Als Jens und Frank schon tief schliefen und Roland auf seinen Stock gestützt vor sich hin döste, trappelte die Kurrende wieder nach vorn. Die machten dabei einen ziemlichen Krach, aber keiner der Hirten merkte was. Als endlich alle Kurrende-Sänger ruhig standen, erschien oben auf der Kanzel der Engel Michaela und sang: „Vom Himmel hoch, da komm ich her...“ Dabei kam Michaela nie und nimmer vom Himmel, sondern aus der Hauptstraße 11. Das wusste Luise ganz genau, denn Michaelas kleine Schwester Claudia war Luises beste Freundin.
Erst sang Michaela allein, dann mit der gesamten Kurrende. Das erschreckte die Hirten ziemlich, aber glücklicherweise hatte Roland sich gemerkt, was Michaela gesungen hatte –
und kaum waren Engel und Kurrende weg, sausten die drei Hirten nach Bethlehem zum Stall.
Marcus durfte schon wieder trällern! Währenddessen hatte Maria ihr Kind bekommen. Luise wusste nicht so ganz genau, wie man ein Kind bekommt. Das interessierte sie sehr, und deshalb nahm sie sich vor, Ina mal zu fragen.
Da trafen auch schon die Hirten im Stall ein. Sie bestaunten das Baby Jesus und schenkten ihm tolle Dinge: eine karierte Decke, eine Rassel und eine geschnitzte Flöte. So eine Flöte – das wär was! Aber daran hatte Luise beim Malen ihres Wunschzettels nicht gedacht...
Endlich! Da kamen die drei Sterngucker aus dem Morgenland. Und sie hießen Sebastian, Nico und Cindy. Jaja, eine Sternguckerin war auch mit dabei! Wunderschön sahen die drei aus in ihren bunten Gewändern. Und jeder der drei hatte ein geheimnisvolles Gefäß bei sich. Sie knieten an der Krippe mit dem kleinen Jesus drin nieder. Sebastian schenkte Gold, Nico Weihrauch und Cindy Myrrhe. Luise hatte keine Ahnung, was Weihrauch und Myrrhe. Luise hatte keine Ahnung, was Weihrauch und Myrrhe sind. Aber ob in Sebastians Kästchen wirklich Gold war, wollte sie zu gerne wissen. Sie überlegte noch, wie sie das wohl rauskriegen könnte, da sang die Kurrende wieder. Aber diesmal durften alle in der Kirche mitsingen, ein Glück!
Schade – schon vorbei, das Krippenspiel. Die Spieler am Altar vorne strahlten, wahrscheinlich weil sie sich alle an der Krippe getroffen hatten. Auch die Wirtin Peggy kam mit hin.
,Ach‘, dachte Luise, ,,muss das toll sein, dort vorn zu stehen und alle Leute gucken dich an.‘
„Wenn ich mal groß bin, spiele ich die Maria“, flüsterte Luise Mama zu. „Und wer soll der Josef sein?“, flüsterte Mama zurück. „Paul“, überlegte Luise, „oder Christoph, oder Thommy, oder Martin. Mal sehen.“ Das würde Luise entscheiden, wenn‘s soweit ist. Nur eines war ihr jetzt schon klar: Ihr Josef würde einer werden, dem seine Maria wichtiger war als seine Laterne!

Mandelstollen (Zutaten ausreichend für 2 Stollen)
Zutaten: 1 kg Mehl, 120 g Hefe, 1/4-1/2 Liter Milch, 500 g Rosinen, 400 g Zitronat, 500 g Butter, 375 g süße und 75 g bittere geriebene Mandeln, 250 g Zucker, 2 Päckchen Vanillinzucker, 1 Prise Salz
Zum Bestreichen: 150 g Butter, 5 EL Zucker, 2 Päckchen Vanillinzucker, 200 g Puderzucker
Zubereitung: Aus Mehl, Hefe und Milch einen Hefeteig kneten (15 Min. gehenlassen). Restliche Zutaten untermengen. Wenn der Teig zu trocken ist, mit etwas Milch anfeuchten. Die Stollen länglich formen, in der Mitte längs etwas einkerben, auf einem gebutterten, leicht bemehlten Backblech nochmals etwa 30 Min. gehenlassen. Bei kräftiger Mittelhitze (180°-200°) backen. Den Stollen abkühlen lassen, gut mit zerlassener Butter einstreichen, mit Zucker und Vanillinzucker bestreuen, nochmals mit zerlassener Butter beträufeln und dick mit Puderzucker bestäuben.
PS I: Der Weihnachtsstollen soll an das in Windeln gewickelte Jesuskind erinnern. Deshalb wird der Teig eigentlich nicht gerollt, sondern wie Windeln übereinander geschlagen. Das verlangt allerdings einige Übung.
Man kann natürlich auch eine Stollen-Backform benutzen. Die hält das Risiko geringer, lässt aber den Stollen (oder die Stolle, wie man auch in Mundart sagt) eher nach Kuchen aussehen.
Minimaus entdeckt das Haus
Helmut Spanner
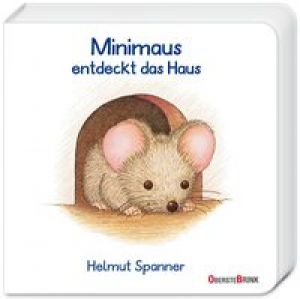
Kurze lustige Texte begleiten Minimaus bei ihren Erkundungen durch das Haus. Gemeinsam mit den kleinen Betrachtern entdeckt sie Alltagsgegenstände und lädt so zum Sprechen und Erzählen ein.
Helmut Spanner beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit der Wahrnehmung von Kleinkindern und zeichnet seine Illustrationen so, dass es den Mädchen und Jungen leicht gelingt, die vertrauten Alltagsgegenstände auch im Buch zu erkennen.
Spielerisch das Alphabet erfahren
Buchstaben zum Tasten, Fühlen, Untersuchen und Befüllen
Mit den „Erfahrungskleinbuchstaben“ entdecken Kinder Buchstaben mit allen Sinnen. Sie können sie abtasten, erfühlen, untersuchen und mit verschiedenen Gegenständen füllen. Dazu sind etwa Pfeifenputzer, Erbsen oder Murmeln bestens geeignet. So lernen die Kinder spielerisch das Alphabet kennen.
Außenräume kindgerecht gestalten
Broschüre „Bildungsraum Garten“ jetzt kostenlos bestellen
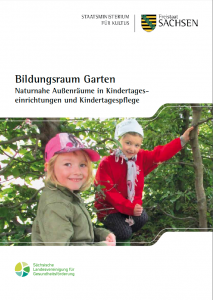
Außenräume in Kindertageseinrichtungen sind wichtige Erlebnisräume für Kinder. In seinem Vorwort der Broschüre „Bildungsraum Garten - Naturnahe Außenräume in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege“ schreibt der Sächsische Staatsminister für Kultus, Christian Piwarz, dazu: „Kinder erleben und erfahren ihre Umwelt mit allen Sinnen, wollen gestalten und verändern, sind aktiv und selbstbestimmt unterwegs. Sie bauen sich anhand ihrer Erfahrungen ein Bild von sich selbst und der Welt auf. Dazu brauchen Kinder anregende Umgebungen, die sie neugierig machen, die auf- und herausfordernd auf sie wirken und die sie zum selbstständigen Denken und Handeln einladen.“ Genau so ist es. Und deshalb betont der Minister auch, die große Bedeutung des Außengeländes in den Einrichtungen für die Entwicklung der Kinder.
Dabei unterliegt die Planung des Außengeländes vielen verschiedenen Kriterien. Leider ordnen viele Erwachsene die Bedürfnisse der Kinder ihren eigenen unter. Das lässt sich dann oftmals auch an den Außengeländen erkennen. Aber welche Bedürfnisse haben Kinder und wie lassen sich Außenräume so gestalten, dass sie diesen auch entsprechen? Darum geht es in der Broschüre. Neben vielen interessanten Beispielen finden sich darin auch viele konkrete Überlegungen dazu, wie ein Konzept, das sich an den Bedürfnissen der Kinder orientiert, erstellt und umgesetzt werden kann.
Diese Broschüre kann kostenlos bestellt werden:
Zentraler Broschürenversand der Sächsischen Staatsregierung
Hammerweg 30, 01127 Dresden
Telefon: 0351 2103671 oder 0351 2103672
Fax: 0351 2103681
E-Mail: publikationen@sachsen.de
Online-Version: Ein PDF-Dokument dieser Broschüre ist im Internet veröffentlicht unter: www.slfg.de
Informationen zur Ausbildung im Gesundheits- und Sozialbereich
GAW-Institut lädt ein zum Tag der offenen Tür in Ilmenau
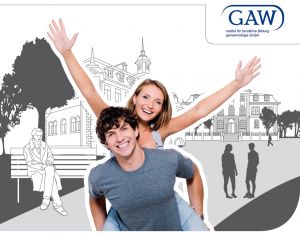
Das Deutsche Erwachsenen-Bildungswerk (DEB) öffnet am 2. Februar 2019 seine Türen für Besucher. Interessenten können sich über die Ausbildung zum Ergotherapeuten, Erzieher und Sozialassistenten informieren, die Unterrichtsräume kennenlernen und mit Lehrkräften und Schülern ins Gespräch kommen.
Die Veranstaltung findet von 15 bis 17 Uhr in der Buttelstedter Straße 90 in Weimar in den Räumen des DEB statt.
Die Besucher erhalten ausführliche Informationen zu Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalten und zum Bewerbungsverfahren sowie Antworten auf individullel Fragen. Außerdem können sie an dem Nachmittag auch ein Blick in die Unterrichts- und Praxisräume werfen.
Interessenten können am Tag der offenen Tür ihre Bewerbung persönlich abgeben.
Weitere Informationen unter:
Ausstellungen, Demonstrationen und Aktionen rund um die Ausbildungen Erzieher (m/w), Sozialassistent (m/w) und Altenpfleger (m/w) gibt es am 23. Februar 2019 in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr in der anerkannten Fachschule und Höheren Berufsfachschule für Gesundheits-, Sozial- und Pflegeberufe des GAW-Instituts, Am Vogelherd 50|51 in 98693 Ilmenau. Schulleitung und Dozenten der berufsbildenden Schule informieren über Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalte und berufliche Perspektiven. Auch persönliche Beratungsgespräche werden angeboten. Bei einem Rundgang können Besucher einen Blick in die Unterrichts- und fachpraktischen Räume der Schule werfen.
Alle Interessierten können ihre Bewerbungen auch gleich mitbringen abgeben.
Weitere Informationen gibt es beim GAW-Institut für berufliche Bildung, Am Vogelherd 50|51, 98693 Ilmenau
Tel: +49(0)3677|84 10 89
Fax: +49(0)3677|87 18 77
E-Mail: ilmenau@gaw.de
Web: www.gaw.de
Facebook: www.facebook.com/GAWIlmenau
Wie Sprache gelingt
Sprache als lebendiges und integriertes Alltagserlebnis für Kinder und Erwachsene

Sprache kann Selbstbildungswelten im Menschen öffnen oder verschließen. Sie wirkt unbemerkt und ständig entwicklungsförderlich oder entwicklungshinderlich auf Kinder. Im Sinne eines entwicklungsförderlichen Prozesses stellt das Kind durch Erlebnisse in den ersten Lebensjahren… einen Bezug zwischen sich und der Welt her, vergewissert sich seiner individuellen Identität und ordnet sich seinem Umfeld zu. Auf der anderen Seite muss festgehalten werden, dass beispielsweise „bei einer Sprachentwicklungsstörung auch Störungen auf der kommunikativ-pragmatischen Ebene bestehen. Eine Störung auf dieser Ebene äußert sich in der verminderten Fähigkeit, Gedanken, Gefühle und Erlebnisse in einer nachvollziehbaren Art und Weise sprachlich zu äußern.“ (Bunse/Hoffschildt, 2008, S. 119). Doch allzu sehr wird derzeitig in der deutschen (Elementar-)Pädagogik die Sprache als ein funktionalisiertes Methodenkompendium betrachtet – dies belegen die ungezählten „Sprachtrainings- bzw. Sprachförderprogramme“.…
Die Sprache ist weitaus mehr als eine bloße Bündelung von gesprochenen und zumeist zusammenhängenden Worten. Sie ist ein lebendiger, lebensnotwendiger, der menschlichen Existenz alltäglicher und Sinn gebender Kommunikationsdialog, der Tag für Tag erlebt, gepflegt und genutzt werden kann und soll … .
|
Sprache ist Erlebnis – und kann Menschen in Erstaunen versetzen. |
|
Sprache ist Genuss – und lässt immer wieder manche kleinen und großen Zuhörer/innen mit offenem Mund besonders spannenden Erzählungen folgen. |
|
Sprache verbindet – und lässt im ersten Augenblick unüberbrückbar erscheinende Grenzen zusammenbrechen. |
|
Sprache erfreut – und bringt Sonne in die Herzen trauriger Menschen. |
|
Sprache beglückt – und eröffnet in einem Gespräch gedankliche Perspektiven, die bis dahin kaum zugelassen werden konnten. |
|
Sprache berührt – und lässt die Menschen in nachsinnende Gedankenwelten kommen, sodass die Gegenwart teilweise in völlige Vergessenheit gerät. |
|
Sprache ist wie die Feder eines Vogels – leicht, beschwingt und wundervoll zu betrachten. Sprache ist wie ein heller Sonnenstrahl – wegweisend, zielgebend und richtungsorientierend. |
Gleichzeitig kann Sprache aber auch wie ein Schwert sein: scharf wie eine frisch geschliffene Klinge, zerstörend und vernichtend. Sie kann sich wie ein Feuer in die Herzen mancher Menschen brennen und eine nachhaltige Wirkung auf den Gesprächspartner haben. Sprache kann aber auch ermüden, abschrecken, Ängste provozieren und krank machen. Sprache kann damit Selbstbildungswelten im Menschen öffnen oder verschließen und wirkt (unbemerkt) permanent entwicklungsförderlich oder entwicklungshinderlich auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene …
Sprache als alltagsbedeutsamer Kommunikationswert
Grundvoraussetzungen und zugleich Lernbedingungen für einen entwicklungsförderlichen Sprachauf- und Sprachausbau ergeben sich primär aus folgenden Aspekten:
- einer sicheren und vertrauensvollen Beziehung zwischen dem Kind und dem Erwachsenen,
- dem Zusammenspiel von Sinneswahrnehmung und einer aktiv beteiligten Motorik,
- einer sich momentan vollziehenden Persönlichkeitsentwicklung des Kindes,
- dem aktuellen Erleben von Sprach- und Sprechfreude,
- einer engagierten Selbsttätigkeit und Selbstaktivität,
- einer lebendigen und zuverlässig erlebten Interaktion,
- einer im Alltag sorgsam gestalteten Dialogpflege,
- einer vielfältigen Sprachnutzung in Alltagssituationen und Alltagsbezügen, die für das Kind bedeutsam und interessant sind,
- einem anregungsreichen Umfeld, das zwar reizvoll, nicht aber reizüberflutend auf das Kind wirkt sowie
- einer Sprachnutzung und einem Spracherleben, das sich an der aktuellen Lebenswelt des Kindes orientiert.
Wie Sprache im Sinne eines alltagsbedeutsamen Kommunikationswertes auf Kinder und dabei besonders auf deren Sprach-/Sprechentwicklung wirkt, zeigen vor allem die vielfältigen Untersuchungsergebnisse von Prof. Dr. Gisela Szagun, die zu den renommiertesten Spracherwerbsforscherinnen Deutschlands gehört (Szagun, G., 2006) und entsprechend formulierte Konsequenzen (2007) konstatiert. Darüber hinaus finden sich viele sprachunterstützende Hinweise in den Arbeiten von Dr. Martine F. Delfos, die seit Jahren über das Thema „Gesprächsführung mit Kindern“ forscht. Weitere Praxishinweise für hilfreiche Grundvoraussetzungen und Lernbedingungen für einen erfolgreichen Sprachauf- und -ausbau liefern Rita Steininger (2004), Bernd Reimann (2009) und Sabine Bunse/Christiane Hoffschildt (2009), Marlies Koenen (2009)und Karin Jampert et al. (2006).
Nur wenn Sprachsituationen in lebendigen Handlungszusammenhängen einbezogen und darüber hinaus gleichzeitig mit gegenwartsorientierten Lebenswirklichkeiten der Kinder verbunden sind, in denen sie selbst Sprechfreude erleben und eigene Deutungen vornehmen können, wird Sprache von Kindern als ein Zielmedium und ein spannendes Ausdrucksmittel angenommen und gerne genutzt. Doch die pädagogische Praxis sieht zumeist diametral anders aus – und das nicht erst seit 2009!
Zwar mag es auf den ersten Blick so wirken, als hätten es Kinder der heutigen Generation besser bzw. leichter, weil sie mehr Spielmittel, größere Bildungschancen, bessere Förderungsmöglichkeiten oder vielschichtigere Kommunikationswege nutzen können. Ein genaueres Betrachten macht aber deutlich, dass es vor allem um eines geht: Kinder müssen eine ständige Zunahme an Erfahrungsverlusten hinnehmen (vgl.: Ellneby, Y., 2001; Konrad, F.-M. + Schultheis, K., 2008; Rittelmeyer, Chr., 2007; DJI, 2009; Alt, Chr., 2008; Hurrelmann, K. et al., 2007)
Sprachaufbau geschieht im Sinne eines beziehungsorientierten „concomitant learning“
Entwicklungspädagogisch muss diese Tatsache sowohl Eltern als auch pädagogische Fachkräfte immer wieder aufs Neue aufrütteln, weil bekannt ist, dass Kinder in den ersten Lebensjahren vor allem aus den vielfältigsten Situationen eines Alltagshandelns lernen (= concomitant learning) (vgl.: Holt, J., 2003; Markowa, D., 2005; Jackel, B., 2008; Astington, J. W., 2000). So entwickeln sich alle kognitiven Prozesse aus einem begeisterten Tun, dem selbst beteiligten Aktiv-Sein, der selbst motivierten Tätigkeit und motorisch herausfordernden Aktivität. Nicht umsonst heißt es in einem alten Spruch: „Aus Erfahrung wird man klug.“ Wenn Kinder in zunehmendem Maße den Erfahrungsverlusten ausgesetzt sind, es aber gleichzeitig ihrer Bestimmung entspricht, sich als mitgestaltende und gleichzeitig lernende Mitakteure in dieser Welt zu begreifen, gibt es nur vorbestimmte Auswege: Entweder resignieren Kinder, ziehen sich zurück und klagen darüber, dass ihnen „so langweilig ist“, oder sie suchen vielfältige Chancen, die Welt dennoch zu entdecken, etwa durch Regel- und Grenzüberschreitungen, Bewegungsüberschüsse oder Aktionismen, indem sie auf sich aufmerksam machen (müssen) nach dem Motto: „Seht doch, hier bin ich.“ Einerseits ist es die Angst davor, übersehen zu werden, die Kinder dazu veranlasst, sich zurückzuziehen oder „auf die Pauke zu hauen“, weil sie ihrem Umfeld klar machen wollen, dass die Planungen bzw. Angebote an ihren originären Bedürfnissen vorbeigehen und andererseits verlieren die Kinder durch diese alltagsfernen Angebote immer stärker ihre Neugierde, ihr Umfeld auf eigene Faust mit Zeit und Ruhe zu erkunden. Langeweile ist das Resultat aus dem anerzogenen Verhaltensmuster, außengesteuerte Erwartungen zu erfüllen, so dass die Bereitschaft, Akteur der eigenen Entwicklung zu werden, nach wiederholten Aufstandsversuchen systematisch nachlässt. Damit gewinnt die Überzeugung Oberhand, dass eigene Vorhaben nicht so bedeutsam zu sein scheinen sondern stattdessen eine Abwartehaltung, um sich als Reakteur in Szene zu setzen, erwünscht zu sein scheint.
Viele elementarpädagogische Fachkräfte und berufspolitische Mandatsträger können die aufgezeigten Gefahren einer völligen Verplanung von Kindheiten nachvollziehen und reagieren entsprechend bedauernd. Doch was ist von dem Versuch, Kindheit als ein eigenständiges Zeitfenster zu begreifen und entsprechend mit Kindern zu erleben, geblieben? Die Praxis zeigt: wenig. Es wird f ü r Kinder gedacht und f ü r sie geplant, f ü r Kinder arrangiert und f ü r Kinder gehandelt anstatt zu begreifen, dass eine „Pädagogik vom Kinde aus“ eine Pädagogik m i t dem Kind ist. Viele elementarpädagogische Fachkräfte haben sich schon vor Jahren darüber aufgeregt, dass Eltern ihren Kindern in immer jüngerem Alter immer mehr Kindheitszeiten vorenthalten haben, indem sie die Tendenz unterstützt haben, Kinder in Arrangements unterzubringen. Mit dem Babyschwimmen, den Krabbelgruppen und frühkindlichen Förderprogrammen fing es an, zog sich über die ungezählten Kurse und Trainings für Kinder weiter (Montag: Ballett/Judo; Dienstag: Flöten-/Klavierunterricht; Mittwoch: Turnen/Fußball; Donnerstag: Reiten/Handball; Freitag: Tennis/frühes Leselernen; Samstag: Sportturniere; Sonntag: frei!?) und setzt(e) sich dann über die Kindergartenzeit fort. Viele Kinder hatten und haben ein Tagesprogramm, das dem eines Managers ähnlich ist.
D.h.: die entfernt gesehene Zukunft wird in die Gegenwart hineingeholt, so dass die Zukunft zur Gegenwart gemacht wird! Diese alltagsweltliche Vorstellung von Erziehung hat eine außergewöhnlich lange Tradition – sie ist von der Antike über die Zeit der Aufklärung, der Moderne, des Faschismus und des Kommunismus bis zur heutigen Zeit bekannt und findet sich erneut und hier besonders stark ausgeprägt in der aktuellen Pädagogik der „bildungsgeprägten Lernpädagogik“. Erlaubt sei ein Rückblick. Der polnische Arzt und Pädagoge Dr. Janusz Korczak gab dazu schon vor über 90 Jahren eine klare Stellungnahme ab, indem er sagte: „Wer die Kindheit überspringen will und dabei in die fern liegende Zukunft zielt - wird sein Ziel verfehlen.“ (1978, S. 20) Statt suchender Fragen, die wir uns aus den Beobachtungen der Kinder ableiten und immer wieder aufs Neue stellen, danach was Kinder am heutigen Tage brauchen, um in weitere Selbstbildungsanstrengungen kommen zu können, trachtet - so Korczak - „die ganz moderne Pädagogik ... danach, bequeme Kinder heranzubilden, sie strebt konsequent und Schritt für Schritt danach, alles einzuschläfern, zu unterdrücken und auszumerzen, was Willen und Freiheit des Kindes ausmacht, seine Seelenstärke, die Kraft seines Verlangens und seiner Absichten. Artig, gehorsam, gut, bequem, aber ohne Gedanken daran, dass es innerlich unfrei und lebensuntüchtig sein wird.“ (1987, S. 12) Was Kinder brauchen sind „Abenteuer für eine echte Kindheit“ (Lee, J., 2005) Wenn Antoine de Saint-Exupery einmal sagte: „Wenn du mit anderen ein Schiff bauen willst, so beginne nicht, mit ihnen Holz zu sammeln, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer“, dann sei die Frage erlaubt, was vielerorts in der Pädagogik tatsächlich passiert. Viele Arbeitsimpulse in der Elementarpädagogik besitzen in zunehmendem Maße den Charakter einer „Kinderbelehrung“ mit der Folge, dass die gesamte Kindergartenpädagogik zu einer „vorgezogenen Schulpädagogik“ mutiert und Kinder zusätzlich irritiert, weil uns neurobiologische Erkenntnisse zeigen, dass Kinder in Zusammenhängen fühlen, denken und handeln (wollen), im Sinne einer nachhaltigen Bildung in Handlungsvernetzungen begreifen müssen und nur das als lernbedeutsam aufnehmen werden, was sie selbst als lernherausfordernd klassifizieren.
Sprachaufbau und -entwicklung ist in Sinnzusammenhänge integriert
Eine so genannte „ganzheitliche“ sprachunterstützende Pädagogik (im Sinne einer nachhaltigen Bildung bzw. Bildung aus erster Hand) ist dann gewährleistet, wenn möglichst alle Entwicklungsbereiche in einer Spiel-, Erlebnis-, Erfahrungs- und Alltagsaktivität des Kindes gleichzeitig angesprochen und beteiligt sind. Entwicklungspsychologisch ist eine Trennung oder ein Herauslösen einzelner Entwicklungsbereiche nicht nur unmöglich, sondern kann auch keine nachhaltigen Bildungsprozesse im Kind bewirken. So sucht man bis heute vergeblich nach Studien, die das Gegenteil beweisen würden.
Kinder sind stets mit all’ ihren Entwicklungsfeldern – gleichzeitig und untrennbar – beteiligt, wenn es ihnen darum geht, die Welt zu erkunden, eigene Stärken zu erleben, neue Entwicklungsmöglichkeiten auszutesten und für sie bedeutsame Lebenserfahrungen zu machen. Die kindeigenen Entwicklungsfelder offenbaren sich in ihrem Denken, ihrer Fantasie, ihrer Kreativität, ihrer Sprache und ihrem Sprechen, ihrer Motorik, ihrer Soziabilität, ihrer Intelligenz, ihrer Motivation und vor allem ihren Gefühle.
Doch statt diese entwicklungspsychologisch bedeutsame Tatsache zur Kenntnis zu nehmen, steckt die Elementarpädagogik und stecken viele Eltern die Kinder in immer mehr pädagogisierte Arrangements, durch die sie ihre eigenen Lernimpulse immer weiter verdrängen und darauf warten, dass es vielleicht noch etwas Spannenderes gibt als ihre erlebte Realität. Der Weg vom Säugling über das Kind zum Jugendlichen und Erwachsenen wird immer kürzer und damit weniger nachvollziehbar für die Kinder selbst und ihr eigenes Leben. Nicht selten entstehen sogenannte Entwicklungsbrüche vielfältigster Art – ausgedrückt als Verhaltensirritationen, auf die die Erwachsenenwelt mit immer neuen, heilsversprechenden therapeutisierten Pädagogikprogrammen reagiert. Dort, wo ein Leben zunehmend in Bedingungen geschieht – und das macht den Alltag auch in manchen Kindertagesstätten aus – wird und ist die aktive Selbstbestimmung vieler Kinder radikal reduziert. Der Alltag ist aus „Fertigbausteinen“ zusammengesetzt, die den Kindern wenig Raum lassen, Forscher, Entdecker, Wissenschaftler mit eigenen Neigungen sein zu können. Janusz Korczak, der bekannte polnische Arztpädagoge, hat einmal gesagt:
|
„Wir belasten Kinder mit neuen Pflichten des Menschen von morgen, ohne ihnen die Rechte des Menschen von heute zuzugestehen. [ ] Um der Zukunft willen wird gering geachtet, was es heute erfreut, traurig macht, in Erstaunen versetzt, ärgert und interessiert. Für dieses Morgen, das es weder versteht noch zu verstehen braucht, betrügt man es um viele Lebensjahre.“ Verteidigt die Kinder, Gütersloh 1987, S.47 |
Kinder brauchen andere Erlebnisse als funktionalisierte Sprachübungen
Damit Kinder nicht noch mehr „Ohnmachtserlebnisse, Auslieferungserlebnisse, Trennungserlebnisse, Beziehungsnöte und Bedrohungsängste“ erfahren müssen, ist es vielleicht hilfreich, sich an das Wort eines unbekannten Apachenkriegers zu erinnern: „Großer Geist, bewahre mich davor, über einen Menschen zu urteilen, ehe ich nicht eine Meile in seinen Mokassins gegangen bin.“ Kinder laden uns jeden Tag dazu ein.
Was Kinder dringender denn je brauchen ist ein Lebens- und Lernumfeld, das vor allem durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:
Sie brauchen ungeteilte Zeiten, in denen sie mit Ausdauer und nach eigenen Zeitempfindungen Dinge in Ruhe zu Ende führen können, und sie brauchen vor allem Erwachsene, die ihre Ausdrucksformen wirklich verstehen, die Symbole ihres Handelns und Erzählens begreifen, und sie brauchen den Kindergarten als einen Ort, an dem sie ein aktives Mitspracherecht haben: von der Gestaltung des Tagesablaufes bis hin zur Kinderkonferenz.
Kinder brauchen offene Ohren, die hören, was Kinder zur Zeit beschäftigt, und sie suchen vielfältige Möglichkeiten, das wirkliche Leben – und keine künstlich gestaltete und strukturierte Welt – kennenzulernen.
Kinder brauchen eine Umgebung, in der sie sich in ihrer Individualität entwickeln können, bevor eine so genannte Sozialentwicklung auf sie einströmt, und sie brauchen Menschen, die ihnen einen Raum zugestehen, in dem sie mit Versuch und Irrtum das Weltgeschehen um sie herum begreifen können.
Sie brauchen Erwachsene (und ein entsprechendes Umfeld), mit denen der Prozesshaftigkeit eine höhere Beachtung geschenkt wird als dem Herstellen von irgendwelchen „ästhetischen Produkten“ und sie brauchen diese Erwachsenen als Bündnispartner zur Umsetzung ihrer ureigenen Interessen.
Sie brauchen und suchen einen Ort, an dem ihr magisch-mythisches Denken – also ihre subjektiv bildhafte Vorstellung von der Welt und deren wirksamen Zusammenhängen – ausreichend Platz findet, erlebt und ausgedrückt wird.
Sie brauchen Mitspieler und keine Dirigenten, die wirklich auf der Ebene von Kindern – im wahrsten Sinne des Wortes – sind, und sie brauchen Erwachsene, die mit ihnen sprechen anstatt auf sie einzureden oder über sie zu sprechen.
Sie brauchen Menschen, die ihre Stärken sehen und nicht gegen ihre vermeintlichen Schwächen kämpfen, und sie suchen Erwachsene, die statt eines Pessimismusses einen hohen Optimismus ausstrahlen, die ihre Stärken sehen und nicht ihre „Schwächen“ minimieren wollen.
Sie suchen Mitmenschen, die sich auf Erfahrungen einlassen und keine Dogmen (Lehrsätze) verbreiten, und sie brauchen Erwachsene, die statt „moralisierender Ratschläge für andere Werte“ selbst ihr eigenes Leben auf der Grundlage einer verinnerlichten Wertemoral gestalten.
Sie wünschen sich Menschen, die loslassen können, statt sich auf bestimmte Rollen und Vorhaben/Ziele zu fixieren, und sie suchen Erwachsene, die sie, statt erziehen zu wollen, ganzheitlich begleiten.
Kinder brauchen Menschen, die Selbsterfahrung auf sich nehmen, statt eigene Gedanken, Gefühle und Muster zu projizieren, und sie suchen Erwachsene, die mit ihnen auf die Suche nach Wahrheiten gehen, statt im Sinne von Recht oder Unrecht zu debattieren und eigene Standpunkte auf Kinder zu übertragen.
Wenn diese (und sicherlich viele weitere) Merkmale für den Kindergarten zutreffen sollen, bedarf es immer wieder einer selbstkritischen Reflexion einrichtungsspezifischer Normen und eingefahrener Verhaltensmuster – im Interesse von Kindern und Erwachsenen sowie einer tatsächlich bildungsorientierten Frühpädagogik.
So bedarf es in der Elementarpädagogik keiner zusätzlichen Intensivräume für besondere Arbeiten, sondern Räume, in denen es überall „intensiv“ zugeht.
Die Kindergartenzeit ist auch keine Zeitspanne eines vorgezogenen Schulübens, sondern ein Leben und Lernen mit Kindern in sinnzusammenhängenden, ganzheitlichen Vorhaben, die sich auf das aktuelle Leben der Kinder mit ihren Themenschwerpunkten beziehen.
Die Elementarpädagogik ist kein Ort, an dem Kinder gesagt bekommen, was sie machen können/sollen/müssen, sondern an dem die Themen der Kinder verstanden und aufgegriffen werden (vgl.: Wiebe, E., 2010, S. 118-134).
Der Kindergarten hat für eine Atmosphäre zu sorgen, in der sich Kinder angenommen und wertschätzend behandelt fühlen. Dabei ist die Umgebung von Kindern als ein Ort zu erfassen, an dem sie sich selber fordern und eigenmotiviert fördern können.
Der Kindergarten hat sich Kindern als ein Ort zu zeigen, an dem das Leben pulsiert, in dem bestehende Alltagsrealitäten ihres erlebbaren Umfeldes erfahren werden können und der jede aufgesetzte Künstlichkeit von inszenierten, erwachsenengesteuerten und herbeigeführten „teilisolierten Förderprogrammen“ aufgibt (vgl.: Lill, G., 2007, S. 18 ff.; Krenz, A.: 2010, S. 121 ff.).
Er hat Kindern die entwicklungsförderliche Möglichkeit zu bieten, unverarbeitete Erfahrungen aufzuarbeiten, um sich von alltäglichem Erwartungsdruck und biographisch ausgelösten Belastungen zu befreien (vgl.: Krenz, A., 2008, S. 201 ff.).
Der Kindergarten muss ein Ort sein, an dem der Phantasiereichtum von Kindern jede Arbeitsschablone überflüssig macht und die Person der Erzieherin bzw. des Erziehers ein von den Kindern geliebter Teil der Gruppe ist.
Der Kindergarten gestaltet dabei seine Arbeit aus einem Selbstverständnis heraus, in dem zunehmend eingesetzte Therapieprogramme durch das gemeinsame, ganzheitliche Leben immer mehr überflüssig werden.
Alltagstaugliches Sprachgeschehen als lernprovozierender Lebensraum
Damit wird der Kindergarten zu einem Ort, an dem mit Kindern zusammen gekocht und gelacht wird, Freude regiert und Regeln gemeinsam ausgehandelt werden, Kinder noch Kinder sein können und nicht als „unfertige Erwachsene“ betrachtet werden, geachtete Rückzugsecken bestehen und Kinder selbstverständlich jeden Tag ihr Spielzeug mitbringen können, Jungen ebenso wie Mädchen zu ihren besonderen Rechten kommen und Gewalt von einer natürlichen Aggression unterschieden wird. Ein Ort, an dem es ebenso Ablehnung, Abgrenzung und Auseinandersetzungen gibt wie unter den Erwachsenen und dabei natürliche Wege gesucht und miteinander gegangen werden, um solche Grenzen zu überwinden; an dem jedes Kind das verbriefte Recht auf Meinungsäußerung – ein in der UN-Charta „Rechte des Kindes“ festgeschriebenes Recht (Artikel 12/13) – besitzt und vor allem das Kind in Erwachsenen ein Modell für das Gesagte erlebt. Viele elementarpädagogische Fachkräfte behaupten mit fester Überzeugung, dass sie sich genau durch diese Merkmale auszeichnen. Doch trifft dabei ein Wunsch- bzw. Ideal-Ich nicht selten auf ein widersprüchliches Realbild. (Hinweis für die Praxis: Es lohnt sich durchaus, diesen Anspruch gezielt in einer Selbstbeobachtung zu überprüfen. Vgl. Krenz, A., 2009, S. 22)
Dort, wo der Kindergarten zu einem alltagstauglichen, bildungsorientierten und lernprovozierenden Lebensraum geworden ist, fühlen sich Kinder angenommen und verstanden. Dies schafft die notwendige Sicherheit für Kinder, sich auf neue Erfahrungen einzulassen, alte Muster zu verändern und mit neuen Verhaltensweisen zu experimentieren.
Der Kindergarten ist in Gefahr, sich allzu schnell auf wieder neue Programme und Richtungen einzulassen – ein Beweis für eine oftmals zu beobachtende Orientierungslosigkeit der gegenwärtigen Elementarpädagogik. Wenn Kinder diesen „lernprovozierenden Bullerbü-Effekt“ (vgl.: Lindgren, A., 2006) – d.h. Sinn gebende, in der Lebensrealität erfahrbare Zusammenhänge zwischen dem real-aktuellen Kinderleben und ihrem real existenten Umfeld – nicht mehr im Kindergarten erleben können, dann müssen sie auch hier resignieren und entwickeln bzw. verfestigen auffällige Verhaltensweisen, die sich folgenotwendig weiter in die Schulzeit verlagern oder die Kinder suchen ihre Erfahrungen „auf der Straße“. Das ist – auf die Gegenwart bezogen – dramatisch und wäre im Hinblick auf die Zukunft fatal. Kinder brauchen nötiger denn je einen beziehungsorientierten und lernintensiven Alltags-Lebensraum – der Kindergarten kann ihn bieten und Kindern nutzbar machen.
Sprachentwicklung braucht sprach- und sprechfreundliche Rahmenbedingungen/Begleiterscheinungen
Wenn Erzieherinnen und Erzieher Wert darauf legen, dass sich Sprache entwickeln, auf- und ausbauen soll, sind zunächst die Faktoren zu identifizieren und zu verändern, die die Sprach- und Sprechentwicklung eines Kindes massiv hemmen:
- unübersichtliche Beziehungsverhältnisse durch zu große Gruppen oder pädagogische „Ansätze“, die sogenannte „feste Gruppen“ ablehnen;
- wenig oder sehr eingeschränkte Bewegungsangebote, die zumeist darauf ausgerichtet sind, den Kindern „gezielte“ Bewegungsmöglichkeiten anzubieten;
- ein wahrnehmungsstörender Lärmpegel, der es Kindern nahezu unmöglich macht, aufeinander zu hören, miteinander in Ruhe zu reden, gemeinsam die Sprache zu erleben; (Hinweis: in einer „pulsierenden Pädagogik“, wo Kinder mit für sie interessanten Themen beschäftigt sind, geht es zwar lebendig und handlungsaktiv, nicht aber automatisch auch „lärmend“ zu.);
- ein gereiztes Sprach-/Sprechklima – ausgelöst durch zunehmend „genervte“ Erwachsene, die voller lernzielorientierter Fördervorgaben oftmals nur noch „Lernergebnisse bei Kindern“ feststellen und dokumentieren wollen;
- Sprachkorrekturen, die die Sprechfreude der Kinder hemmen;
- Hektik, Unruhe, Chaos, Streit, Zeitfresser, Sprachunterbrechungen, die eine sprachunfreundliche Atmosphäre ausbreiten;
- ein Zeit unterbrochenes Zuhören, weil Erwachsene mit allzu vielen Nebentätigkeiten beschäftigt sind und immer weniger Ruhe besitzen, sich ganz und gar auf Gesprächserlebnisse mit Kindern einzulassen;
- ein „Nachäffen“ von Sprach-/Sprechfehlern, das vielleicht als „Ansporn“ gedacht, aber immer als „Verletzung“ erlebt werden wird;
- ein monologisierendes Einreden auf Kinder, das nicht selten als sprachabschreckend von Kindern empfunden wird;
- wenn Kindern Sprach-/Sprechäußerungen abgenommen werden;
- wenn Kindern viel zu früh Antworten auf ihre Fragen gegeben werden, anstatt mit ihnen nach Antworten zu suchen und
- wenn eine „kognitive“ Sprache eingesetzt wird, statt einer emotional positiv besetzten – beziehungsorientierten – Sprache. Eine solche beziehungsorientierte Sprache kann nur dort geschehen, wo elementarpädagogische Fachkräfte Kinder nicht nur >verstehen< sondern ihr Verhalten/ihre Sprachaussagen fühlend fühlen.
Der/die Erzieher/in als sprachunterstützender Ausgangspunkt für Sprachentwicklung
Es besteht heute überhaupt kein Zweifel daran, was die Sprache nachhaltig fördert (vgl.: Mannhard, A. + Braun, W. C., 2008; Weinert, S., 2007 + 2008; Weinert, S. + Grimm, H., 2008; Mietzel, G., 2002; Tracy, R., 2007). Entsprechende Hinweise finden sich daher auch in nahezu allen länderspezifischen Orientierungs- und Bildungs(rahmen)richtlinien für Kindertageseinrichtungen! Eine „integrierte Sprachförderung“ (Best, P. + Zehnbauer, A., 2009/Michalak, M., 2008) geschieht vor allem durch die Merkmale, die Sprachäußerungen außergewöhnlich stark aktivieren, provozieren, lebendig werden lassen: alltäglich miteinander sprechen; miteinander singen; miteinander dichten und reimen; Dialoge lebendig pflegen und gemeinsam auf die Suche nach Antworten gehen; miteinander philosophieren; Kinderaktivitäten sprachlich begleiten; gemeinsames Genießen einer lebendigen Bewegungskultur; Geschichten vorlesen und nacherzählen; Märchen vorlesen und nachspielen; Geschichten erfinden und aufschreiben; miteinander spielen; sorgsam aufeinander hören; Hörspiele erfinden und aufzeichnen; Kindergartenzeitungen erstellen und drucken; Kinderkonferenzen gemeinsam gestalten.
Entsprechend der bekannten Aussage von Pestalozzi, dass „Erziehung Liebe und Vorbild ist – sonst Nichts!“, muss es in einer sprachförderlichen Erziehungs- und Bildungsatmosphäre vor allem um die eigene Sprach- und Sprechkultur der elementarpädagogischen Mitarbeiter/innen und die der Elementarpädagogik zugeordneten Fachkräfte gehen.
Sprache ist für Kinder ein alltägliches, lebendiges, entwicklungsförderliches Kommunikationserlebnis mit Kindern und Sprachbildung von Kindern versteht sich in erster Linie als eine Herausforderung an die hohe Sprachkompetenz von bindungsorientierten Erwachsenen!
Die verschiedenen Merkmale des eigenen Sprechverhaltens, die eine sprachförderliche oder sprachhinderliche Auswirkung auf Kinder haben, äußern sich in der Stimmfarbe, der Stimmkraft, im Sprechtempo, der Aussprache, dem Satzbau, den möglicherweise genutzten Sprachmarotten und dem Sprechausdruck. (vgl.: Mannhard, A. + Braun, W.C., 2008)
Wir alle haben sicherlich ein Bild von unserer gelebten Alltagssprache. Wir glauben, eher einfühlsam, annehmbar, freundlich, aufgeschlossen, einladend, und insgesamt kommunikationsförderlich zu sprechen.
Gleichzeitig ist es so, dass unser Wunschbild häufig einem Idealbild entspricht und mit der Wirklichkeit – dem Realbild – nicht unbedingt übereinstimmen muss.
Aus diesem Grunde sei ein Sprach-/Sprechreflexionsbogen vorgestellt, der wie ein Spiegel zur Hand genommen werden kann, um einerseits selbst eine Sprach- bzw. Sprechanalyse vorzunehmen oder andererseits – was noch effektiver ist – eine Kollegin/einen Kollegen zu bitten, bei der Spracherfassung sowie einer kritischen Bestandsaufnahme behilflich zu sein.
So kann der folgende Reflexionsbogen gezielt dabei helfen, sein eigenes Sprach- und Sprechverhalten zu erfassen und ggf. Maßnahmen zu ergreifen, um notwendige Veränderungen vorzunehmen:
|
Aussprache |
Satzbau |
Sprach-marotte |
Sprechbeginn/-ausdruck |
Sprechtempo |
Stimmkraft |
Stimmfarbe |
|
deutlich |
einfach struk-turiert |
häufige Wiederholungen |
ängstlich |
langsam |
leise |
weich |
|
undeutlich |
mittellang |
„Ich würde sagen“ |
ungeduldig |
mittel |
(zu) laut |
hart |
|
näselnd |
lang |
„irgendwie“ |
fragend |
schnell |
dynamisch |
melodisch |
|
nuschelig |
eintönig (nur: Subjekt, Prädikat, Ergänzung) |
viele „Äh“ |
originell |
hastig, rasend |
gepresst |
voluminös |
|
akzentuiert |
verschach-telt |
viele „und“ |
bestimmend |
abgehackt |
entspannt |
flach |
|
stockend |
kompliziert |
viele „ich“ |
schüchtern |
ohne Pausen |
schrill |
hell |
|
näselnd |
vollständig |
viele Fremd-wörter |
rücksichtsvoll (nicht mit der „Türe ins Haus fallen“) |
mit Pausen |
schneidend |
dunkel |
|
lispelnd |
abgebro-chen |
viele Angli-zismen |
rücksichtslos |
mit zu langen Pausen |
gleichbleibend |
kippend (wechselnd zwischen hoch + tief) |
|
über-deutlich |
abstrakt |
„Ich sag‘ mal …“ |
lebhaft |
„ohne Luft zu holen“ |
wechselnd |
betonend |
|
sorgfältig |
konkret |
viele „ne“ am Satzende |
sicher |
einschläfernd |
gewaltig |
voll |
|
rhyth-misch |
grammati-kalisch korrekt |
„eigentlich“ |
spannend |
gehetzt |
zurückhaltend |
leer |
|
fließend |
grammati-kalisch falsch |
„Man sollte …“ |
fesselnd |
|
|
|
|
|
|
„Ja aber ...“ |
interessant |
|
|
|
„Gute Sprachförderung“ ist alltäglich hörbar. Test- und Sprachförderverfahren mögen Erwachsene beruhigen – Kinder werden durch sie nicht selten massiv beunruhigt. Die Methodengläubigkeit und didaktisierte Vielfalt in der Elementarpädagogik setzt den eigenen Entwicklungszeitraum Kindheiten mit seinen besonderen Erfordernissen zunehmend aufs Spiel. Insofern ist aus entwicklungspsychologischer, sprachwissenschaftlicher und entwicklungspädagogischer Sicht ein Perspektivwechsel dringender denn je notwendig!
Literatur
Alt, Christian (Hrsg.) (2008): Kinderleben – Industrielle Entwicklungen in sozialen Kontexten. Band 5. Wiesbaden: Schriftenreihe des Deutschen Jugendinstituts
Astington, Janet W. (2000): Wie Kinder das Denken entdecken. München: Ernst Reinhardt
Becker-Stoll, Fabienne & Textor, Martin R. (Hrsg.) (2007): Die Erzieherin-Kind-Beziehung. Zentrum von Bildung und Erziehung. Mannheim: Cornelsen
Best, Petra + Zehnbauer, Anne (2009): Kinder-Sprache stärken. Anregungen für eine integrierte Sprachförderung. In: TPS, Heft 4, S. 46–50
Blank-Mathieu, Margarete (2010): Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen. In: Krenz, Armin: Handbuch für ErzieherInnen in Krippe, Kindergarten, Kita und Hort. München: Olzog. Teil 4, Beitrag Nr. 40, S. 1–40
Bunse, Sabine + Hoffschildt, Christiane (2008): Sprachentwicklung und Sprachförderung im Elementarbereich. München: Olzog
Delfos, Martine F. (2004): „Sag‘ mir mal …“ – Gesprächsführung mit Kindern (4–12 Jahre). Weinheim, Basel: Beltz
DJI – Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.) (2009): Das Wissen über Kinder – eine Bilanz empirischer Studien. DJI Bulletin, Nr. 85, Heft 1/2009
Ellneby, Ylva (2001): Kinder unter Stress. Was wir dagegen tun können. München: Beust
Fink, Michael (2005): Gute Sprachförderung sieht man nicht. Sprachtest im Vergleich. In: klein & groß, Heft 07–08/2005, S. 23–25
Fischer-Olm, Anna (2006): „… und dann hat die Erzieherin zu mir gesagt“. Wie Eltern die Sprachentwicklung ihres Kindes unterstützen können. Dortmund: Borgmann Media Taschenbuch
Fink, Michael (2005): Gute Sprachförderung sieht man nicht. Sprachtest im Vergleich. in: klein&groß, Heft Nr. 07-08, S. 22–25
Friedrich, Hedi (2003): Beziehungen zu Kindern gestalten. 3. Aufl. Weinheim, Basel: Beltz
Gardner, Howard (1993): Der ungeschulte Kopf. Wie Kinder denken. Stuttgart: Klett-Cotta
GEW – Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (Hrsg.) (2007): Sprache fördern – Bildung ganzheitlich entfalten. Frankfurt a. M.
Günster, Ursula (2007): Kinder auf ihrem Weg begleiten. Lahr: Kaufmann
Held, Susanne (2006): Vorlesen oder die Kunst, Bücher in Kinderherzen zu schmuggeln. Stuttgart: Klett-Cotta
Holt, John (2003): Wie kleine Kinder schlau werden. Selbständiges Lernen im Alltag. Weinheim: Beltz
Hurrelmann, Klaus/Andresen, Sabine/TNS Infratest Sozialforschung (2007): Kinder in Deutschland 2007. 1. World Vision Kinderstudie. Frankfurt a. M.: World Vision Deutschland e.V.
Jackel, Birgit (2008): Lernen, wie das Gehirn es mag. Kirchzarten: VAK
Jampert, Karin/Leuckefeld, Kerstin/Zehnbauer, Anne + Best, Petra (2006): Sprachliche Förderung in der Kita. Wie viel Sprache steckt in Musik, Bewegung, Naturwissenschaften und Medien? Weimar/Berlin: verlag das netz
Koenen, Marlies (2009): Sprache anfassen. Ein Werkstattbuch. Weimar/Berlin: verlag das netz
Konrad, Franz-Michael + Schultheis, Klaudia (2008): Kindheit. Eine pädagogische Einführung. Stuttgart: Kohlhammer
Korczak, Janusz (1978): Verteidigt die Kinder! Erzählende Pädagogik. Gütersloh (3. Aufl. 1987): Gütersloher Verlagshaus G. Mohn
Korczak, Janusz: (1987): Wie man ein Kind lieben soll. Göttingen (9. Aufl.): Verlag Vandenhoeck + Ruprecht
Krause, Christina + Lorenz, Rüdiger-Felix (2009): Was Kindern Halt gibt. Salutogenese in der Erziehung: Göttingen: Vandenhoeck + Ruprecht
Krenz, Armin (2010): Was Kinder brauchen. Aktive Entwicklungsbegleitung im Kindergarten. 7. Aufl. Mannheim: Cornelsen Verlag Scriptor
Krenz, Armin (2008): Der „Situationsorientierte Ansatz“ in der Kita. Grundlagen und Praxishilfen zur kindorientierten Arbeit. Troisdorf: Bildungsverlag EINS
Krenz, Armin (2007): Psychologie für Erzieherinnen und Erzieher. Grundlagen für die Praxis. Mannheim: Cornelsen Verlag Scriptor
Krenz, Armin (2007): Werteentwicklung in der frühkindlichen Bildung und Erziehung. Mannheim: Cornelsen
Krenz, Armin (2008): Kinder brauchen Seelenproviant. München: Kösel-Verlag
Krenz, Armin (2009): Beobachtung und Entwicklungsdokumentation im Elementarbereich. München: Olzog
Kurzwernhart, Petra Johanna (2009): Sprachstandserhebungsverfahren im Überblick unter Berücksichtigung von linguistischen Grundlagen, Mehrsprachigkeitsdiagnostik, Basisqualifikationen, Gütekriterien und Verfahrensarten. Diplomarbeit an der Universität Wien
Lee, Jeffrey (2005): Abenteuer für eine echte Kindheit. Die Anleitung. München: Piper
Lentes, Simone (2004): Ganzheitliche Sprachförderung. Weinheim, Basel, Berlin: Beltz
Lindgren, Astrid (2006): Das entschwundene Land. München: Deutscher Taschenbuch Verlag
Lill, Gerlinde (2007): Bildungsblüten oder Verplanung und Verregelung von Kinderzeit. In: Betrifft KINDER, Heft 08-09, S. 18–20
Mannhard, Anja + Braun, Wolfgang G. (2008): Sprache erleben – Sprache fördern. Praxisbuch für ErzieherInnen. München: Ernst Reinhardt
Markova, Dawna (2005): Wie Kinder lernen. Eine Entdeckungsreise für Eltern und Lehrer. Kirchzarten: VAK
Mietzel, Gerd (2002): Wege in die Entwicklungspsychologie. Kindheit und Jugend. Weinheim: Psychologie Verlags Union, S. 141 ff.
Michalak, Magdalena (2008): Sprachförderung im Alltag. In: klein&groß, Heft 5/2008, S. 34–37
Rauschenbach, Petra (2010): Lern- und Frühförderprogramme im reichhaltigen Angebot der Elementarpädagogik und Konsequenzen für eine professionell gestaltete Elementarpädagogik. In: Krenz. Armin (Hrsg.) (2010): Handbuch für ErzieherInnen in Krippe, Kindergarten, Kita und Hort. 57. Ausgabe, Juli 2010, Teil 4, Beitrag Nr. 49. München: Olzog
Reimann, Bernd (2009): Im Dialog von Anfang an. Die Entwicklung der Kommunikations- und Sprachfähigkeit in den ersten drei Lebensjahren. Berlin, Düsseldorf: Cornelsen Scriptor
Rittelmeyer, Christian (2007): Kindheit in Bedrängnis. Zwischen Kulturindustrie und technokratischer Bildungsreform. Stuttgart: Kohlhammer
Schäfer, Gerd E. (2005): Bildungsprozesse in der frühen Kindheit. In: Sozial extra, Nr. 1/2005, S. 6–11
Schäfer, Gerd E. (1999): Sinnliche Erfahrung bei Kindern. In: Materialien zum 10. Kinder- und Jugendbericht, Band 1: Lepenies, A. et al. (Hrsg.): Kindliche Entwicklungspotentiale. Opladen: Budrich, S. 152–290
Schweiger, Martina (2005): Ein neuer Blick auf die Bildungsprozesse von Kindern. DJI Bulletin, Nr. 71, Sommer 2005, S. 2
Steininger, Rita (2004): Wie Kinder richtig sprechen lernen. Sprachförderung – ein Wegweiser für Eltern. Stuttgart: Klett-Cotta.
Szagun, Gisela (2006): Sprachentwicklung beim Kind – ein Lehrbuch. Weinheim: Beltz
Szagun, Gisela (2007): Das Wunder des Spracherwerbs. So lernt Ihr Kind sprechen. Weinheim, Basel: Beltz
Szagun, Gisela (2006): Sprachentwicklung beim Kind. Ein Lehrbuch. Weinheim, Basel: Beltz.
Textor, Martin R.: (2008): Wider die Verschulung des Kindergartens. Selbstbildung und ko-konstruktives Lernen zulassen. In: klein&groß, Heft 05/2008, S. 38–43
Tracy, Rosemarie (2007): Wie Kinder Sprachen lernen. Tübingen: Francke
Weinert, Sabine (2007): Spracherwerb. (Seite 221–231). In: Hasselhorn, Marcus + Schneider, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch der Entwicklungspsychologie. Göttingen: Hogrefe
Weinert, Sabine + Lockl, Kathrin (2008): Sprachförderung. In: Petermann, Franz + Schneider, Wolfgang (Hrsg.): Enzyklopädie der Psychologie, Angewandte Entwicklungspsychologie, Band 7, S. 92–134
Weinert, Sabine + Grimm, Hannelore (2008): Sprachentwicklung. In: Oerter, Rolf + Montada, Leo: Entwicklungspsychologie, 6. vollständig überarbeite Auflage. Weinheim: Psychologie Verlags Union, S. 502–534)
Wiebe, Edeltraud (2010): Kinder haben ein Recht darauf, verstanden zu werden. In: Krenz, Armin (Hrsg.): Kindorientierte Elementarpädagogik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht